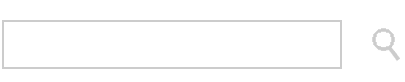Fehlermeldung
- Notice: Undefined index: field_altartikelin in include() (Zeile 40 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: darf in include() (Zeile 33 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/field--field-foto.tpl.php).
- Notice: Undefined index: de in makebio() (Zeile 44 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in makebio() (Zeile 44 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in makebio() (Zeile 44 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: de in makebio() (Zeile 47 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in makebio() (Zeile 47 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in makebio() (Zeile 47 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: de in makebio() (Zeile 49 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in makebio() (Zeile 49 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in makebio() (Zeile 49 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: de in makebio() (Zeile 50 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in makebio() (Zeile 50 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in makebio() (Zeile 50 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: de in makebio() (Zeile 56 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in makebio() (Zeile 56 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in makebio() (Zeile 56 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: de in makebio() (Zeile 61 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in makebio() (Zeile 61 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in makebio() (Zeile 61 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: de in include() (Zeile 144 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 144 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 144 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Undefined index: de in include() (Zeile 154 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 154 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 154 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Undefined index: de in include() (Zeile 174 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 174 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 174 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Undefined index: de in include() (Zeile 184 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 184 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 184 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Undefined index: de in include() (Zeile 194 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 194 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 194 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Undefined index: de in include() (Zeile 204 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 204 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 204 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Undefined index: de in include() (Zeile 214 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 214 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 214 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Undefined index: de in include() (Zeile 224 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 224 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 224 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Undefined index: de in include() (Zeile 264 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 264 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 264 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Undefined index: de in include() (Zeile 274 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 274 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 274 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Undefined index: de in include() (Zeile 291 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 291 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (Zeile 291 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Undefined index: de in include() (Zeile 293 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: bio in include() (Zeile 295 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: fassung3 in autoren() (Zeile 1786 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined offset: 1 in autoren() (Zeile 1797 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in autoren() (Zeile 1797 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined offset: 2 in autoren() (Zeile 1802 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in autoren() (Zeile 1802 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined offset: 3 in autoren() (Zeile 1807 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in autoren() (Zeile 1807 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getlexika() (Zeile 1102 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1102 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1102 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getlexika() (Zeile 1106 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in getlexika() (Zeile 1106 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getlexika() (Zeile 1159 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1159 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1159 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getlexika() (Zeile 1165 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1165 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1165 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined variable: ii in getlexika() (Zeile 1198 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getlexika() (Zeile 1102 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1102 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1102 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getlexika() (Zeile 1106 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in getlexika() (Zeile 1106 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getlexika() (Zeile 1159 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1159 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1159 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getlexika() (Zeile 1165 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1165 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1165 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getlexika() (Zeile 1102 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1102 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1102 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getlexika() (Zeile 1106 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in getlexika() (Zeile 1106 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getlexika() (Zeile 1159 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1159 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1159 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getlexika() (Zeile 1165 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1165 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getlexika() (Zeile 1165 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 891 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in getliteratur() (Zeile 891 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined variable: ii in getliteratur() (Zeile 999 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 891 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in getliteratur() (Zeile 891 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 891 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in getliteratur() (Zeile 891 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 891 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in getliteratur() (Zeile 891 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 891 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in getliteratur() (Zeile 891 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 887 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 891 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in getliteratur() (Zeile 891 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 950 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getliteratur() (Zeile 956 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined variable: array in getliteratur() (Zeile 1048 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getoquellen() (Zeile 1272 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1272 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1272 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getoquellen() (Zeile 1274 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in getoquellen() (Zeile 1274 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getoquellen() (Zeile 1323 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1323 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1323 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getoquellen() (Zeile 1328 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1328 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1328 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined variable: ii in getoquellen() (Zeile 1359 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getoquellen() (Zeile 1274 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in getoquellen() (Zeile 1274 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getoquellen() (Zeile 1323 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1323 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1323 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getoquellen() (Zeile 1328 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1328 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1328 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getoquellen() (Zeile 1323 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1323 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1323 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getoquellen() (Zeile 1328 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1328 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1328 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in EntityAPIController->load() (Zeile 219 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
- Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (Zeile 388 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/includes/entity.inc).
- Notice: Undefined index: und in getoquellen() (Zeile 1272 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1272 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1272 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getoquellen() (Zeile 1274 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in getoquellen() (Zeile 1274 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getoquellen() (Zeile 1323 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1323 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1323 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getoquellen() (Zeile 1328 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1328 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getoquellen() (Zeile 1328 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant deep - assumed 'deep' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1413 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant internetdatum - assumed 'internetdatum' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1421 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant deep - assumed 'deep' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1423 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant internetdatum - assumed 'internetdatum' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1436 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant deep - assumed 'deep' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1413 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant internetdatum - assumed 'internetdatum' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1421 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant deep - assumed 'deep' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1423 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getinternet() (Zeile 1424 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getinternet() (Zeile 1424 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getinternet() (Zeile 1424 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant internetdatum - assumed 'internetdatum' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1436 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant deep - assumed 'deep' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1413 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant internetdatum - assumed 'internetdatum' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1421 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant deep - assumed 'deep' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1423 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant internetdatum - assumed 'internetdatum' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1436 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant deep - assumed 'deep' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1413 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant internetdatum - assumed 'internetdatum' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1421 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant deep - assumed 'deep' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1423 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined index: und in getinternet() (Zeile 1424 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getinternet() (Zeile 1424 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in getinternet() (Zeile 1424 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Warning: Use of undefined constant internetdatum - assumed 'internetdatum' (this will throw an Error in a future version of PHP) in getinternet() (Zeile 1436 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined variable: bio in include() (Zeile 400 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/themes/fplneu/node--biographischer-artikel.tpl.php).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in zitierweise() (Zeile 1829 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in zitierweise() (Zeile 1829 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined offset: 2 in zitierweise() (Zeile 1847 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined offset: 1 in zitierweise() (Zeile 1858 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in zitierweise() (Zeile 1858 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined offset: 2 in zitierweise() (Zeile 1867 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in zitierweise() (Zeile 1867 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined offset: 3 in zitierweise() (Zeile 1875 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Trying to access array offset on value of type null in zitierweise() (Zeile 1875 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined variable: neuname in zitierweise() (Zeile 1885 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined variable: neuname2 in zitierweise() (Zeile 1917 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined variable: neuname3 in zitierweise() (Zeile 1921 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Notice: Undefined variable: neuname4 in zitierweise() (Zeile 1925 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/bombo/bombofunktionen/bombofunktionen.module).
- Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in FieldCollectionItemEntity->fetchHostDetails() (Zeile 378 von /var/www/vhosts/bec2659.online-server.cloud/frankfurter-personenlexikon.de/sites/all/modules/field_collection/field_collection.module).
Sie sind hier
Schmerling, Anton von

Anton von Schmerling
Lithografie von Valentin Schertle nach einem Lichtbild von Hermann Biow [aus: Die Männer des deutschen Volks (...), oder Deutsche National-Gallerie, 1848].
Bildquelle: Bayerische Staatsbibliothek, München (Sign. BA/4 Germ.g. 261 i-1, URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb11122016-6).

Anton von Schmerling
Fotografie (um 1865).
Verfasser von Memoiren („Denkwürdigkeiten“, Ausgabe in Auszügen, 1993; Manuskript im Besitz des Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien).
Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. Hausorden der Treue des Großherzogs Leopold von Baden (1849) und Großkreuz des Österreichisch-kaiserlichen Leopold-Ordens (1854) sowie Ehrenbürgerschaft von Wien (1861) und vielen anderen Städten. Ehrenmitglied (seit 1862), später Curator-Stellvertreter der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.
Artikel aus: Frankfurter Biographie 2 (1996), S. 300f., verfasst von: Sabine Hock (überarbeitete Onlinefassung für das Frankfurter Personenlexikon von Sabine Hock).
Lexika: Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. durch die Historische Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften. 56 Bde. München/Leipzig 1875-1912.Franz Ilwof in: ADB 54 (1908), S. 56-72. | Best, Heinrich/Weege, Wilhelm: Biographisches Handbuch der Abgeordneten der Ffter Nationalversammlung 1848/49. Düsseldorf 1996. (Handbücher zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien 8). Taschenbuchausgabe: Düsseldorf 1998. (Droste-Taschenbücher Geschichte 919).Best/Weege, Taschenbuchausgabe 1998, S. 298. | Klötzer, Wolfgang: Abgeordnete und Beobachter. Kurzbiographien und Literaturnachweise. In: Wentzcke, Paul: Ideale und Irrtümer des ersten deutschen Parlaments (1848-1849). Heidelberg 1959. (Sonderausgabe des dritten Bandes von Darstellungen und Quellen zur Geschichte der deutschen Einheitsbewegung im 19. und 20. Jahrhundert, im Auftr. der Gesellschaft für burschenschaftliche Geschichtsforschung hg. v. Paul Wentzcke und Wolfgang Klötzer).Klötzer/Wentzcke: FNV, S. 299. | Koch, Rainer (Hg.): Die Ffter Nationalversammlung 1848/49. Ein Handlexikon der Abgeordneten der deutschen verfassungsgebenden Reichs-Versammlung. Bearb. v. Patricia Stahl unter Mitwirkung von Roland Hoede, Leoni Krämer, Dieter Skala im Auftr. der Arbeitsgruppe Paulskirche. Kelkheim 1989.Koch: FNV, S. 360f. | Kosch, Wilhelm: Biographisches Staatshandbuch. Lexikon der Politik, Presse und Publizistik. 2 Bde. Bern/München 1963.Kosch: Staatshdb., Bd. 2, S. 1079. | Neue Deutsche Biographie. Hg. v. d. Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 28 Bde. Berlin 1953-2024. Fortgesetzt ab 2020 als: NDB-online (www.deutsche-biographie.de/ndbonline).Helmut Rumpler in: NDB 23 (2007), S. 132-134. | Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 (ÖBL). Hg. v. d. Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 16 Bde. Wien 1957-2022.K. Vocelka in: ÖBL 10 (1994), S. 234f. | Richel, Arthur: Katalog der Abteilung Fft. [der Ffter Stadtbibliothek]. Bd. 2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte. Ffm. 1929.Richel, S. 519.
Literatur:
Quellen: ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/6.516.
Internet: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_von_SchmerlingWikipedia, 9.12.2016.
GND: 119233460 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).
Stand des Artikels: 23.9.2025
Erstmals erschienen in Monatslieferung: 12.2016.
Ein Projekt der Frankfurter Bürgerstiftung
Förderer: Cronstett- und Hynspergische evangelische Stiftung, Stiftung Niederländische Gemeinde Augsburger Confession
Kooperationspartner: Frankfurter Historische Kommission
Projektleitung: Sabine Hock
Herausgeber: Clemens Greve, Sabine Hock
Datenbankprogrammierung: Andreas Bombel
Gestaltung: Anja Müller-Ries
Bildnachweis für die Kopfleiste (v. l. n. r.): Hamman von Holzhausen (Hans Happ nach Conrad Faber von Creuznach/UB Ffm.), Arthur Schopenhauer (ISG), Friedrich Stoltze (ISG), Johann Wolfgang Goethe (Johann Heinrich Lips/FDH-FGM), Max Beckmann (ISG), Bertha Pappenheim (ISG), Eduard Rüppell (Pompeo Marchesi/Archiv der SGN/Foto: Sven Tränkner), Paul Ehrlich (ISG), Christian Egenolff (Johann Friedrich Schmidt nach dem Monogrammisten „M“/ISG), Karl der Große (Andreas Artur Hoferick nach Karl Eduard Wendelstadt/Foto: Wolfgang Faust), Franz Adickes (ISG), Liesel Christ (hr-Archiv/Foto: Kurt Bethke), Ernst May (ISG), Georg Philipp Telemann (Valentin Daniel Preisler nach Ludwig Michael Schneider/ISG).
© ab 2014 Frankfurter Bürgerstiftung und für die einzelnen Artikel bei den Autoren und/oder Institutionen.